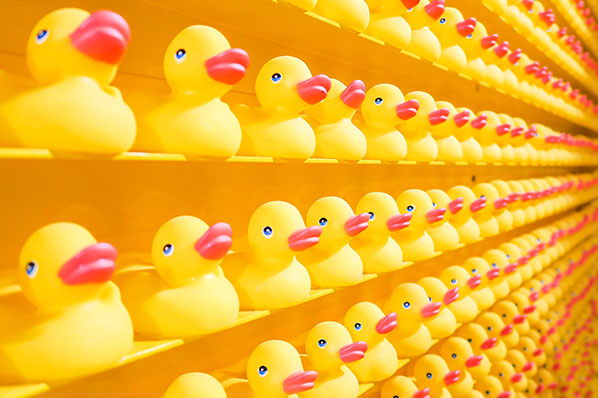„Der Mensch kann zwar tun, was er will. Er kann aber nicht wollen, was er will.“ Das stellte schon Schopenhauer fest und brachte damit ein wesentliches Charakteristikum des Menschen auf den Punkt: Unsere Gefühle können wir nur sehr bedingt beeinflussen – und wie stark sie unser Verhalten lenken, ist uns oft gar nicht bewusst.
Das Neuromarketing nutzt moderne Verfahren der Hirnforschung, um hier Licht ins Dunkel zu bringen. Wie genau das funktioniert und welche Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften Marketer und Marketerinnen nutzen können, erfahren Sie in diesem Artikel.
Neuromarketing: Eine Definition
Was ist Neuromarketing?
Neuromarketing ist eine Marktforschungs- und Marketingdisziplin, die sich die Erkenntnisse der Psychologie und insbesondere der Neurowissenschaften zunutze macht, um Marketingmaßnahmen zu optimieren.
Als Unterkategorie der Werbepsychologie konzentriert sich das Neuromarketing also auf die Prozesse, die im Gehirn Kaufentscheidungen beeinflussen. Je nach konkreter Definition werden nur solche Prozesse berücksichtigt, die mithilfe apparativer Verfahren (wie EEG und fMRT) zu beobachten sind, oder sämtliche Erkenntnisse, die aus der Forschung über Abläufe und Mechanismen im Gehirn bekannt sind.
Über konkreten Ideen stehen dabei zwei Grundannahmen, die wissenschaftlich gut belegt sind und es nötig machen, Forschungsergebnisse zurate zu ziehen:
-
Menschliche (Kauf-)Entscheidungen basieren nicht ausschließlich auf rationalen Überlegungen. Stattdessen spielen zum Beispiel multisensorische Komponenten (Gerüche, Haptik, Musik), Emotionen oder die konkret genutzte Sprache eine wesentliche Rolle.
-
Wir sind uns dieser Einflussfaktoren zu einem großen Teil nicht bewusst. Deshalb reichen klassische Fragebogen- oder Interviewverfahren der Marktforschung nicht aus, um sie zu identifizieren.
Anwendung können die gewonnenen Erkenntnisse bei allen Marketinginstrumenten finden, zum Beispiel:
-
Gestaltung von Webseiten und E-Mails/Newslettern
-
Produkt-/Verpackungsdesign
-
Gestaltung des Point-of-Sale (online wie offline)
-
Anzeigendesign
-
Aufbau und Design von Werbespots
Was macht Neuromarketing? Ein Beispiel
Betrachten wir eine klassische Studie von Susanne Erk und Kollegen aus dem Jahr 2002, um eine Idee davon zu bekommen, wie Forschung im Bereich Neuromarketing funktioniert. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben untersucht, inwiefern Produkte, die soziale Dominanz und Wohlstand ausdrücken, Belohnungscharakter haben.
Dazu zeigten sie zwölf männlichen Probanden Fotos verschiedener Autoklassen (Sportwagen, Limousinen, Kleinwagen) und maßen währenddessen die Hirnaktivität mittels fMRT (mehr zu dieser Methode weiter unten). Anschließend wurden die Probanden gebeten, die Attraktivität der Autos zu bewerten.
Das Ergebnis: Sportwagen wurden nicht nur als deutlich attraktiver wahrgenommen, sondern haben im Gegensatz zu den anderen Autos auch gezielt bestimmte Hirnareale angesprochen, die zum sogenannten dopaminergen System gehören. Dieses löst belohnungsbezogene Glücksgefühle aus und spielt eine wesentliche Rolle in der Entstehung einer Sucht.
Konkret bedeutet das: Produkte, die von Kundschaft mit Prestige und sozialem Status verbunden werden, lösen starke positive Emotionen aus und haben einen Belohnungscharakter, der sogar physisch messbar ist – es zahlt sich also aus, in einen entsprechenden Markencharakter zu investieren.

Einführung in die Marketing-Psychologie
Erzählen Sie uns etwas von sich, um in wenigen Klicks auf den Leitfaden zuzugreifen:
- Grundprinzipien Psychologie
- Psychologische Effekte
- Psychologie im Marketing
- Beispiele aus der Praxis
Die Limbic Map und Limbic Types
Ein ganzes Modell rund um die Erkenntnisse der Neurowissenschaften hat Hans-Georg Häusel mit seiner Limbic Map aufgestellt. „Limbic“ nimmt dabei Bezug auf das Limbische System des Gehirns, das maßgeblich für die Emotionsverarbeitung verantwortlich ist. Das Motiv- und Emotionsstrukturmodell bezieht dabei die Erkenntnisse der verschiedensten Wissenschaften ein, darunter
-
Genetik,
-
Neurochemie,
-
Neuroanatomie,
-
Psychologie und
-
Evolutionsbiologie
und hilft sowohl bei der Zielgruppenanalyse als auch bei der Markenpositionierung sowie der Gestaltung von Marketinginstrumenten.
Das Modell unterscheidet drei wesentliche Emotionssysteme oder -räume:
-
Stimulanz
-
Dominanz
-
Balance
Die Limbic Map stellt diese drei Systeme in einen Zusammenhang. Denn aus der Kombination der drei Systeme ergeben sich verschiedene Motive und Werte, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
-
Dominanz + Balance: Disziplin, Kontrolle
-
Dominanz + Stimulanz: Abenteuer, Thrill
-
Balance + Stimulanz: Fantasie, Genuss

Auf Basis dieser Werte und Motive lassen sich sieben sogenannte „Limbic Types“ unterscheiden, die sich durch verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, aber auch aktuelle Stimmungen auszeichnen. Diese Typen können Marketer und Marketerinnen ideal zur Zielgruppenanalyse anhand von neuropsychologischen Prinzipien heranziehen:
-
Harmonisierer: Sie zeichnet eine starke Familienorientierung aus. Sie sind wenig statusgetrieben und sehnen sich vielmehr nach Geborgenheit.
-
Offener: Dieser Typ ist offen für Neues und zeichnet sich durch Toleranz aus.
-
Hedonist: Der Hedonist sucht ständig nach neuen Impulsen, zeichnet sich durch hohen Individualismus aus und ist sehr spontan.
-
Abenteurer: Dieser Typ verfügt über hohe Risikobereitschaft und ist äußerst impulsiv.
-
Performer: Performer sind stark leistungsorientiert und ehrgeizig. Sie streben einen hohen sozialen Status an.
-
Disziplinierter: Er ist äußerst pflichtbewusst und detailverliebt, gleichzeitig nicht sehr konsumgetrieben.
-
Traditionalist: Der Traditionalist ist nicht sehr zukunftsorientiert, sondern wünscht sich vielmehr Ordnung und Sicherheit.
Wesentliche Erkenntnisse aus dem Neuromarketing
Aber auch abseits solcher komplexen Modelle hat das Neuromarketing wichtige psychologische Mechanismen identifiziert oder präzisiert, die in modernem, kundenorientiertem Marketing eine entscheidende Rolle spielen. Im Folgenden erklären wir exemplarisch besonders zentrale Effekte.
Herding
Herding oder ein Herdentrieb zeichnet den Menschen als soziales Wesen aus. Wir neigen stark dazu, unser Verhalten an dem Vorbild anderer bzw. einer Gruppe zu orientieren. Dieses Verhalten hat sich evolutionspsychologisch bewährt, weil es stets dafür gesorgt hat, dass Individuen Teil einer Sippe blieben – wo sie deutlich bessere Überlebenschancen hatten als auf sich alleine gestellt.
Die neurologische Basis für dieses Imitationsverhalten sind die sogenannten Spiegelneurone, die uns helfen, die Intention unseres Gegenübers zu verstehen und uns entsprechend zu verhalten. Das können sich Marketer und Marketerinnen auf vielfältige Weise zunutze machen:
-
Ein besonders effektives Tool sind hier Kundenbewertungen. Denn sie ermöglichen potenziellen Kunden, sich in Einklang mit der Masse der anderen Kundinnen zu verhalten, indem sie besonders gut und häufig bewertete Produkte kaufen.
-
Auch Hinweise wie „X Kunden schauen sich dieses Produkt gerade an“ erzeugen einen Herding-Effekt. Pluspunkt: Zusätzlich suggerieren sie Knappheit und provozieren damit einen Kaufdruck.
-
Besonders stark ist der Imitationsdrang bei Prominenten. Berühmte Testimonials zahlen daher ebenfalls auf Herding-Verhalten ein.
Nudging
Der Begriff des Nudgings wurde 2008 von Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler und Rechtswissenschaftler Cass Sunstein geprägt. Darunter werden Methoden zusammengefasst, mit denen das Verhalten von Menschen subtil beeinflusst werden kann, ohne auf klare Ge- und Verbote zu setzen oder eindeutige ökonomische Anreize (wie etwa Rabatte) zu setzen.
Hierbei handelt es sich also um einen Sammelbegriff, der die unterschiedlichsten Mechanismen zur Verhaltensmodifikation zusammenfasst, darunter:
-
Default-Regeln: Menschen orientieren sich in der Regel am Status quo. Das liegt zum einen am bereits erklärten Herding, zum anderen an einer gewissen Bequemlichkeit, aktiv die aktuelle Situation zu ändern. Diesen Mechanismus macht sich zum Beispiel Amazon zunutze, wenn bei der Auswahl eines Produkts nicht der einmalige Kauf, sondern das Abo-Modell voreingestellt ist.
-
Erinnerungen: Menschen neigen dazu, vor allem elementare Informationen zu behalten – dazu gehören Marketingbotschaften in der Regel nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, potenzielle Kundschaft mehrfach mit einer Werbebotschaft zu konfrontieren oder zum Beispiel Retargeting zu nutzen. Auch E-Mails, die Nutzende an Produkte in ihrem virtuellen Warenkorb erinnern, zahlen hierauf ein.
-
Erhöhung der Bequemlichkeit: Kognitionswissenschaftler bezeichnen Menschen gerne als „cognitive misers“ (also etwa „kognitive Geizhälse“), da wir in vielen Situationen dazu neigen, so wenig geistige Anstrengung wie nötig aufzuwenden. Marketer und Marketerinnen sollten deshalb in möglichst allen Belangen auf Bequemlichkeit und Einfachheit setzen: Dazu gehören möglichst leicht verständliche Slogans genauso wie möglichst wenig Klicks bis zum abgeschlossenen Kauf eines Produkts.
Priming und somatische Marker
Beim sogenannten Priming wird die Verarbeitung eines Reizes (zum Beispiel eines Produkts, einer Webseite oder einer Anzeige) dadurch beeinflusst, dass zuvor ein anderer Reiz (Hinweisreiz) gezeigt wurde, der implizite (also unbewusste) Gedächtnisinhalte aktiviert hat.
Was kompliziert klingt, haben wir alle schon erlebt: Der Geruch von Zimt und Vanille löst in uns ein wohliges Weihnachtsgefühl aus, das wir mit Kindheit und Geborgenheit verbinden. Ein Foto von paradiesischen Stränden im Sonnenuntergang erinnert uns an die pure Entspannung, die wir im letzten Sommerurlaub empfunden haben.
Das ist auf sogenannte somatische Marker zurückzuführen: Starke Emotionen werden in unserem Gehirn zusammen mit dem entsprechenden Kontext abgespeichert und reaktiviert, sobald wir mit passenden Reizen konfrontiert werden.
Sind diese Gefühle einmal geweckt, neigen wir dazu, sie auf Reize zu übertragen, die uns in Folge gezeigt werden – das ist Priming. Marketer und Marketerinnen können also sehr gezielt beeinflussen, wie eine Werbeanzeige, ein Produkt oder eine Verpackung wahrgenommen wird, indem sie die Umgebung entsprechend gestalten.
Plätzchengeruch am Point of Sale in der Weihnachtszeit kann beispielsweise dafür sorgen, dass wir das ausgestellte Produkt als besonders wohlig wahrnehmen. Das Foto eines idyllischen Strandes fördert gegebenenfalls den Buchverkauf, da es verspricht, dass wir uns beim Lesen in den letzten Urlaub zurückträumen können.
Storytelling
Lange bevor die Schrift erfunden wurde und der Großteil der Menschen Lesen und Schreiben gelernt hat, wurden Informationen vor allem mündlich weitergegeben – überwiegend in Form von Geschichten. Diese jahrtausendealte Praxis hat dafür gesorgt, dass wir bis heute Geschichten besonders gut verarbeiten können:
-
Sie erhalten besonders leicht unsere Aufmerksamkeit.
-
Wir neigen dazu, Informationen, die uns in Geschichtenform vermittelt wurden, besser zu erinnern.
-
Wir können uns besonders gut in die handelnden Personen hineinversetzen.
Deshalb sollten auch Marketingbotschaften idealerweise in Form von Geschichten vermittelt werden. Denn das birgt noch einen weiteren Vorteil: Es macht uns Spaß, Geschichten zuzuhören. Deshalb fühlen wir uns in diesem Fall von Werbung nicht genervt, sondern hören und sehen gerne zu. Wie das geht, zeigt zum Beispiel der Weihnachtswerbespot 2021 von Penny.
Quelle: YouTube / ErstmalzuPenny
Methoden im Neuromarketing
Kurzüberblick
| Methode | Was misst / liefert | Stärken | Grenzen / Hinweise | Typische Nutzung |
|---|---|---|---|---|
| EEG | Elektroden messen elektrische Aktivität an der Kopfoberfläche; zeigt, wann/wo ein Reiz verarbeitet wird. | Nicht-invasiv; hohe zeitliche Auflösung. | Vergleichsweise niedrige räumliche Auflösung; tiefe Hirnschichten kaum abbildbar. | Reizpräsentation (z. B. Webseite/Produkt) – Zeitpunkt/Ort der Verarbeitung abschätzen. |
| fMRT | Unterschiede zwischen sauerstoffreichem und -armem Blut als indirektes Aktivitätssignal. | Sehr gute räumliche Auflösung; exakte Lokalisierung aktiver Areale. | Suboptimale zeitliche Auflösung; teuer/aufwändig; benötigt Magnetresonanztomograph. | Lokalisierung, wo Aktivität stattfindet. |
| Eye-Tracking | Erfasst Blickbewegungen/Blickpunkte; macht Aufmerksamkeitslenkung sichtbar. | Zeigt, was zuerst bzw. am längsten betrachtet wird. | Kurze Fixationen sind mehrdeutig interpretierbar. | Analyse von Anzeigen und Webseiten (erste/ längste Fixationen). |
| Pulsfrequenz-Messung | Herzschläge/Minute als Indikator für Erregungsniveau (Arousal). | Bezug zu Aufmerksamkeit/Verarbeitungstiefe; mittleres Arousal fördert Erinnerung. | Keine Aussage zur Emotion (valenz); zusätzliche Befragungen nötig. | Arousal-Erfassung; anregende Reize (z. B. Bilder, knallige Farben, Musik). |
| Hautleitfähigkeits-Messung | Elektrodermale Aktivität: Schwitzen ↑ → Leitfähigkeit der Haut ↑ → Hinweis auf Erregungszustand. | Gibt Aufschluss über Arousal. | (Im Abschnitt keine weiteren Grenzen genannt.) | U. a. Einsatz bei Lügendetektortests. |
Neuromarketer und -marketerinnen nutzen zwar auch klassische Marktforschungsinstrumente wie Fragebögen und qualitative Interviews, greifen aber zum Erkenntnisgewinn vor allem auf apparative Methoden der Neurowissenschaften zurück. Dazu gehören unter anderem die folgenden:
EEG
Beim EEG (Elektroenzephalographie) messen zahlreiche über den Schädel verteilte Elektroden die elektrische Aktivität, die für die Reizweiterleitung im Gehirn notwendig ist. Zeigt sich an einer Elektrode ein elektrisches Signal, das über das permanente elektrische Rauschen des Gehirns hinausgeht, wird davon ausgegangen, dass ein Areal im Umfeld dieser Elektrode aktiv ist.
Wird Probanden und Probandinnen also ein Reiz präsentiert (wie beispielsweise eine Webseite oder ein Produkt), gibt das EEG einen Hinweis darauf, wann und wo dieser Reiz verarbeitet wird.
Die Vorteile des EEGs liegen vor allem darin, dass es nicht-invasiv ist und eine hohe zeitliche Auflösung bietet – es zeigt also präzise, wie schnell nach Reizpräsentation das entsprechende Signal in welchem Hirnareal verarbeitet wird. Nachteilig dagegen ist die vergleichsweise niedrige räumliche Auflösung.
Es lässt sich also nur grob feststellen, wo das gemessene Signal seinen Ursprung hat. Aktivität in tieferen Hirnschichten (unterhalb der Hirnrinde) lässt sich sogar so gut wie gar nicht abbilden.
fMRT
Das Kürzel fMRT steht für „funktionelle Magnetresonanztomographie“. Mithilfe von Magnetfeldern kann hier sauerstoffhaltiges von sauerstoffarmem Blut unterschieden werden. Die Idee: Ist ein Hirnareal aktiv, benötigt es Energie und verbraucht dementsprechend Sauerstoff. Deshalb steigt der Sauerstoffbedarf und mehr sauerstoffhaltiges Blut fließt in die entsprechende Region.
Areale, die laut fMRT viel sauerstoffhaltiges Blut aufweisen, scheinen also gerade aktiv zu sein.
Der Vorteil: Die räumliche Auflösung ist sehr gut, es ist also exakt zu erkennen, wo Aktivität stattfindet. Die zeitliche Auflösung dagegen ist suboptimal und erlaubt keine klare zeitliche Bestimmung von neuronalen Reaktionen.
Außerdem ist die Methode, für die ein spezieller Magnetresonanztomograph in passenden Räumlichkeiten benötigt wird, teuer und vergleichsweise aufwändig.
Eye-Tracking
Die Eye-Tracking-Technologie ermöglicht es, die exakten Augenbewegungen von Konsumierenden nachzuvollziehen. Kameras zeichnen die Position der Pupille auf und machen so sichtbar, wohin genau die Person schaut. Das gibt vor allem Aufschluss über die Aufmerksamkeitslenkung.
Besonders beliebt ist diese Methode zur Analyse von Werbeanzeigen oder Webseiten. So lässt sich nachvollziehen, welche Bereiche als erstes und/oder am längsten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen – in der Regel sind das vor allem menschliche Gesichter und Überschriften. Erst nachgelagert werden längere Textblöcke betrachtet.
Allerdings lassen sich die erhobenen Daten nicht immer eindeutig interpretieren. Fixiert die Person eine Überschrift nur kurz, kann das beispielsweise auf zweierlei Weise interpretiert werden: Entweder die Überschrift war leicht verständlich oder sie konnte die Aufmerksamkeit nicht nachhaltig binden.
Pulsfrequenz-Messung
Auch der Puls, also die Zahl der Herzschläge pro Minute, kann zur Analyse herangezogen werden. Denn der Puls gibt Aufschluss über das Erregungsniveau – in Fachkreisen „Arousal“ genannt. Das wiederum hat Konsequenzen für Aufmerksamkeit und Verarbeitungstiefe: Bei mittlerem Erregungsniveau (wenn Konsumierende also weder gelangweilt noch gestresst, sondern angenehm animiert sind) ist die Aufmerksamkeit maximal und aufgenommene Informationen werden lange erinnert. Ein solcher Arousal lässt sich vor allem über animierende Reize wie Bilder von Kindern, knallige Farben oder Musik herstellen.
Das Problem bei der Pulsfrequenz-Messung: Sie lässt erst einmal keine Rückschlüsse darauf zu, welche Emotionen der gezeigte Reiz auslöst, die dann zum gemessenen Arousal führen – also ob es sich beispielsweise um positiv gespannte Aufregung oder ängstlichen Stress handelt. Um das zu erfassen, bedarf es zusätzlicher Befragungen der Probanden und Probandinnen.
Hautleitfähigkeits-Messung
Auch die sogenannte elektrodermale Aktivität gibt Aufschluss über den individuellen Erregungszustand. Denn sobald wir aufgeregt oder nervös sind, schwitzen wir verstärkt, insbesondere an den Händen. Durch die zunehmende Feuchtigkeit verbessert sich die elektrische Leitfähigkeit der Haut, was durch dieses Verfahren ermittelt wird. Abseits vom Neuromarketing findet das Verfahren übrigens auch bei Lügendetektortests Anwendung.
Kritik: „Das automatische Gehirn“?
So spannend und verlockend die Erkenntnisse und Möglichkeiten des Neuromarketings klingen, wird auch immer wieder Kritik an der Disziplin laut.
Diese bezieht sich zum einen auf die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Resultate. Denn die vorgestellten Methoden liefern in erster Linie Hinweise auf Korrelationen und Effekte, keine eindeutigen Eins-zu-Eins Zusammenhänge. Unser Gehirn ist deutlich zu komplex, als dass wir es auf simple und einhundertprozentige Wenn-Dann-Kausalitäten herunterbrechen können.
Das wird exemplarisch an den Interpretationsproblemen bei Eye-Tracking und der Hautleitfähigkeitsmessung deutlich. Oft lassen Messergebnisse mehrdeutige Interpretationen zu oder finden sich nur unter hochkontrollierten Laborbedingungen, die sich in der Praxis nicht herstellen lassen.
Der zweite Kritikpunkt betrifft dagegen ethische Aspekte: Als das Neuromarketing um die Jahrtausendwende herum aufkam, mehrten sich Befürchtungen, Konsumierende würden nun zu Opfern ihrer Hirnchemie werden und der Manipulation durch Unternehmen hilflos ausgeliefert sein. Diese Bedenken lassen sich aber weitestgehend entkräften oder zumindest relativieren. Denn die Idee eines „Kaufschalters“ im Kopf, den Marketer und Marketerinnen lediglich umlegen müssen, greift viel zu kurz.
Auch Maßnahmen, die auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, machen Kunden und Kundinnen nicht zu willenlosen Werbesklaven. Zwar zielt Werbung natürlich immer auf eine Änderung von Einstellungen ab – das gilt aber für klassisches Marketing nicht weniger als für Neuromarketing.
5 Tipps aus dem Neuromarketing
Abschließend haben wir noch ein paar handfeste Tipps zusammengefasst, mit denen Sie sich die Psychologie im Marketing.ö,. zunutze machen können.
Tipp 1: Sprechen Sie die Spiegelneurone an
Spiegelneurone haben wir ja bereits angesprochen. Sie helfen uns allerdings nicht nur bei der Imitation von Verhalten, sondern sind auch essenziell für unser Empathieempfinden. Denn sie sorgen im engsten Sinne dafür, dass wir mit unserem Gegenüber mitfühlen.
Erstmals wurden sie Anfang der 1990er Jahre in Affen entdeckt. Beobachteten diese eine Person, die bestimmte Handbewegungen ausführten, wurden die gleichen Hirnareale aktiv, die auch für die Ausführung dieser Bewegungen beim Affen selbst zuständig sind. Spiegelneurone sorgen also dafür, dass wir das, was wir bei anderen beobachten, fast so empfinden, als würde es uns selbst geschehen.
Auf diese Weise lassen sich auch Emotionen in der Werbung herstellen. Zeigen Sie das Bild einer Person, die voller Genuss in einen Schokoriegel beißt, schlagen die Spiegelneurone an und der potenziellen Kundschaft läuft selbst das Wasser im Mund zusammen. Genauso wirken auch tragische Bilder, die einen negativen Affekt ausdrücken.
Fotos von traurigen, verzweifelten oder ängstlichen Menschen lösen Bestürzung und Mitleid aus, was beispielsweise unsere Spendenbereitschaft für Non-Profit-Unternehmen erhöhen oder im Rahmen von Präventionskampagnen verhindern kann, dass wir uns gesundheitsschädlich verhalten.
Tipp 2: Vergessen Sie den Homo Oeconomicus
Lange Zeit waren sich Betriebs- und Sozialforschende einig, dass Menschen sich nach perfekt logischen Prinzipien verhalten: Entscheidungen werden demnach grundsätzlich so gefällt, dass wir den größtmöglichen (materiellen) Nutzen generieren. Müssen wir uns beispielsweise zwischen zwei Produkten entscheiden, würden wir dementsprechend immer das mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis wählen.
Inzwischen wissen wir allerdings (wie in diesem Beitrag mehrfach gezeigt), dass zahlreiche andere Motive menschliche (Kauf-)Entscheidungen beeinflussen: Wir wollen es möglichst einfach haben, den Normen unserer sozialen Bezugsgruppe zu entsprechen, uns kurzfristig gut fühlen und unsere Entscheidung leicht vor anderen rechtfertigen können – allesamt Bedürfnisse, die der Entscheidung für das objektiv beste Produkt entgegenstehen (können).
Emotionen sind also viel essenzieller für unsere Kaufentscheidungen, als lange vermutet wurde. Das belegt beispielsweise ein bekannter Versuch aus dem Jahr 2003. Teilnehmende sollten sowohl Pepsi als auch Coca-Cola trinken und anschließend entscheiden, welches Getränk ihnen besser schmeckt. Mal handelte es sich um einen Blindversuch, mal waren die Marken klar zu erkennen.
Der Clou: Im Blindversuch entschieden sich die meisten Probanden für Pepsi, waren die Marken allerdings zu erkennen, wurde Coca-Cola favorisiert. Die Auswertung von fMRT-Bildern zeigte warum: Der Anblick des Coca-Cola-Logos löste Aktivität in den Zentren aus, die mit dem eigenen Selbstbild assoziiert sind. Die emotionale Aufladung einer Marke kann also schwerer wiegen, als das augenscheinlich wichtigste Kriterium – nämlich der Geschmack.
Tipp 3: Lassen Sie Blicke sprechen
Menschliche Gesichter bannen unsere Aufmerksamkeit. Blicke spielen dabei eine ganz besondere Rolle – das zeigen Eye-Tracking-Studien. Sie lenken gezielt die Aufmerksamkeit der Betrachtenden, denn diese folgen intuitiv dem Blick von Personen auf Werbematerialien.
Deshalb ist es sinnvoll, dass diese auf den Bereich einer Webseite oder Anzeige schaut, der besonders relevant ist – beispielsweise ein Call-to-Action, der Markenname oder die Abbildung des Produkts.
Werden die Darstellungen von Menschen falsch eingesetzt, können Sie dagegen kontraproduktiv sein. Schaut ein Model den Betrachter zum Beispiel direkt an, zieht das Gesicht unwillkürlich die Aufmerksamkeit auf sich. Das kann allerdings durchaus ein unerwünschter Effekt sein, wenn auf diese Weise von wichtigen Komponenten (wie dem Markennamen oder Logo) abgelenkt wird.
Tipp 4: Machen Sie Verpackungen zu Geschenken
Wer liebt es nicht, Geschenke auszupacken? Die Spannung und Vorfreude machen den Moment zu etwas Besonderem. Diesen Effekt können Marketer und Marketerinnen beim Verpackungsdesign nutzen.
Denn insbesondere im E-Commerce haben Bestellungen im Grunde den Charakter von Geschenken: Wir müssen eine Weile auf sie warten, was die Vorfreude steigert. Gleichzeitig halten wir das bestellte Produkt erst nach dem Auspacken das erste Mal wirklich in den Händen – das erhöht die Spannung.
Dieses Gefühl können Sie noch verstärken, indem Sie die Verpackung nicht nur als zweckmäßigen Schutz, sondern als Teil des Auspackerlebnisses verstehen. Hochwertige Materialien mit angenehmer Haptik und Kartons in markengerechten Farben statt langweiligem Braun erfüllen diesen Zweck. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Kundschaft nicht als allererstes mit der Rechnung konfrontiert wird.
Denken Sie lieber darüber nach, eine Karte à la „Vielen Dank für Ihre Bestellung“ beizulegen. Das verstärkt den Eindruck, ein persönliches Geschenk erhalten zu haben und emotionalisiert den Moment des Auspackens – eine gute Voraussetzung, um Kundschaft zum erneuten Kauf zu bewegen.
Tipp 5: Sexappeal ist nicht alles
Erotische Reize erhöhen das Arousal-Niveau und damit die Aufmerksamkeit – das haben wir bereits beschrieben. Ein mittleres Arousal-Level ist dabei ideal. Ist das Erregungsniveau zu hoch, sind wir zwar aufmerksam, verarbeiten Informationen aber nicht mehr besonders tief und erinnern uns tendenziell schlecht. Das ist ein Problem bei Werbung, die auf Sexappeal setzt: Sie zieht zwar unweigerlich die Aufmerksamkeit auf sich – lenkt sie aber auch vom Produkt auf den erotischen Reiz.
Da die Anzeige nicht tief verarbeitet wird, fällt außerdem das Wiedererkennen schwer: Versuche zeigen, dass die ansprechende Anzeige als Ganzes zwar im Gedächtnis bleibt, Teilnehmende aber nach einiger Zeit nur noch selten wissen, für welches Produkt oder welche Marke dabei eigentlich geworben wurde. Beides gilt natürlich nur dann, wenn der Reiz den sexuellen Präferenzen des Probanden oder der Probandin entspricht. Die alte Werbe-Weisheit „Sex sells“ gilt also nur bedingt.
DACH-Case: Raiffeisen (Schweiz) – Beratung erlebbar gemacht
Die Schweizer Beratungsfirma ZUTT & PARTNER beschreibt mehrere Projekte mit Raiffeisen, bei denen neuromarketing-inspirierte Konzepte eingesetzt wurden: u. a. eine neue Filialgestaltung („aus der Kunden-Perspektive“) und ein „Beratung-zum-Anfassen“-Format, das komplexe Bankthemen haptisch und multisensorisch vermittelt.
- Ziel: Banking-Themen intuitiver, emotional anschlussfähig und verständlich erlebbar machen.
- Ansatz: Multisensorik, Gamification/Erlebnis-Elemente, klare Blickführung & vereinfachte Informationsstruktur.
- Hinweis: Die Fallbeschreibung nennt keine öffentlichen KPIs; Fokus liegt auf Konzept & Umsetzung.
Quelle: Projektübersichten von ZUTT & PARTNER zu Raiffeisen-Projekten (Filial-Erlebnis & Beratungs-Erlebnis). Cases ansehen
Fazit: Dank Neuromarketing die Kundschaft verstehen
Neuromarketing ist kein gruseliger Zaubertrick, der uns in willenlose Marionetten verwandelt. Genauso wenig ist es ein Allheilmittel für Marketer und Marketerinnen, die so „nach Schema F“ effektive Werbung am Fließband produzieren können. Aber die Erkenntnisse aus der Hirnforschung helfen Ihnen dabei, die fundamentalen Prozesse zu verstehen, die bei potenzieller Kundschaft im Laufe der Buyer’s Journey ablaufen.
Auf dieser Basis können Sie Marketinginstrumente designen, die an diese Prozesse angepasst sind und mit Ihrer Markenkommunikation optimal auf die (unbewussten) Bedürfnisse Ihrer Kundschaft eingehen. So kreieren Sie einen maximalen Mehrwert, der sich am Ende für beide Seiten bezahlt macht.
Titelbild: ThitareeSarmkasat / iStock / Getty Images Plus
Neuromarketing


![→ Handbuch Marketing-Psychologie [Kostenloser Download]](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/53/b1b50863-5502-4e83-970b-2382461f3be9.png)