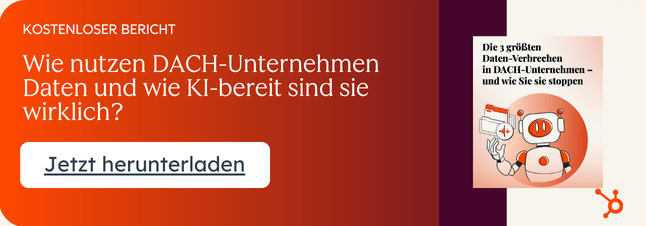Das Wichtigste in Kürze
50 Prozent der DACH-Unternehmen verlieren mehr als ein Viertel ihres Kundenwissens bei Personalwechseln. Fehlendes Wissensmanagement kostet nicht nur Produktivität, sondern auch Kundenvertrauen und Millionenbeträge.
- Das Ausmaß: 50 % der DACH-Unternehmen verlieren mehr als ein Viertel ihres Kundenwissens bei Personalwechseln
- Die Ursache: 88 % kommunizieren regelmäßig außerhalb des CRM in unsichtbaren Side Channels
- Die Realität: Nur 16 % der DACH-Unternehmen sehen sich laut BARC als wirklich datengetrieben
- Die Lösung: Nachhaltige Datenkultur durch strukturierte Dokumentation und zentrale Plattformen
Lesezeit: 7 Minuten
Wenn Wissen verloren geht, verlieren Unternehmen weit mehr als Informationen – sie verlieren Geschwindigkeit, Kundenverständnis und Kontinuität. Fehlendes Wissensmanagement kostet nicht nur Produktivität, sondern auch Kundenvertrauen und Millionenbeträge durch den erneuten Beziehungsaufbau. Dieses Problem ist strukturell und betrifft besonders den DACH-Raum.
Inhaltsverzeichnis
Das unterschätzte Risiko im Alltag
HubSpot-Daten aus der HubSpot EMEA-Umfrage, mit mehr als 300 Führungskräften aus dem DACH-Raum, liefert Klarheit: 50 Prozent der DACH-Unternehmen verlieren mehr als ein Viertel ihres Kundenwissens, wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen. Bei 17 Prozent geht sogar mehr als die Hälfte des wertvollen Wissens verloren.
Der Grund liegt auf der Hand: Informationen werden in E-Mails, Chat-Tools oder persönlichen Notizen geteilt, aber nicht zentral dokumentiert. 88 Prozent der Befragten geben an, regelmäßig außerhalb des CRM zu kommunizieren. Diese sogenannten Side Channels sind zwar bequem, aber sie sind unsichtbar für die Organisation.
Das Resultat dieser fragmentierten Informationslandschaft: Neue Teammitglieder starten unter Umständen bei null, Kundeninformationen gehen verloren und Projekte verlieren an Kontext. Was jahrelang in Beziehungen investiert wurde, verschwindet mit dem ausscheidenden Mitarbeitenden. Heißt alles muss mühsam und kostspielig neu aufgebaut werden.
Die versteckten Kosten des Wissensverlusts
- Geschwindigkeit: Neue Mitarbeitende brauchen Monate, um sich einzuarbeiten und produktiv zu werden.
- Kundenverständnis: Präferenzen, Vorgeschichte und Beziehungskontext gehen unwiederbringlich verloren.
- Kontinuität: Projekte stocken, weil wichtige Zusammenhänge und Hintergründe fehlen.
- Kundenvertrauen: Wiederholte Fragen und fehlende Informationen frustrieren die Kundschaft nachhaltig.
- Millionenbeträge: Der erneute Beziehungsaufbau bindet erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen.
Datenkultur als Gegenmittel
Eine nachhaltige Datenkultur sorgt dafür, dass Wissen nicht von einzelnen Personen abhängt, sondern strukturiert dokumentiert und geteilt wird. Unternehmen mit klaren Datenrichtlinien reagieren schneller auf Marktveränderungen und treffen präzisere Entscheidungen.
Eine integrierte CRM-Plattform fördert genau diese Datenkultur: Sie verbindet Wissen, Prozesse und Kommunikation, sodass Teams abteilungsübergreifend auf aktuelle Informationen zugreifen und voneinander lernen können. Der entscheidende Unterschied liegt in der systematischen Erfassung statt sporadischer Dokumentation.
Best Practice: Austrian Airlines AG
Ein positives Beispiel liefert die Austrian Airlines AG: Während der Pandemie gelang es der Lufthansa-Tochter, Wissen aus dezentralen Teams zu bündeln, Prozesse zu dokumentieren und Kundeninformationen zentral zu speichern. Das Unternehmen reagierte schneller auf Marktveränderungen und stärkte seine Kundenbindung trotz Krise. Dieses Beispiel zeigt: Systematisches Wissensmanagement ist nicht nur Schadensbegrenzung, sondern ein strategischer Wettbewerbsvorteil.
Wichtig zu wissen: Eine gute Datenstrategie schützt nicht nur vor Chaos, sondern indirekt auch vor Sicherheitsrisiken – denn strukturierte Daten lassen sich leichter kontrollieren und schützen.
Hohe Erwartungen ohne Strategie
Viele Organisationen erwarten datengetriebene Entscheidungen. Doch ohne klare Strategie bleibt es beim Wunschdenken. Eine Studie des Analystenhauses BARC zeigt, dass sich nur 16 Prozent der DACH-Unternehmen als wirklich datengetrieben sehen. Die meisten verfügen über Insellösungen und hoffen auf den Effekt neuer Tools.
Doch nachhaltige Datenresilienz entsteht nicht durch Technologie, sondern durch Haltung. Sie verlangt, dass Wissen dokumentiert, zugänglich und überprüfbar bleibt – unabhängig davon, wer im Unternehmen arbeitet.
Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität hat konkrete Folgen: Laut einer Splunk-Studie berichten 47 Prozent der Unternehmen, dass ihr Datenvolumen in den letzten drei Jahren um mindestens 50 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig kämpfen laut Talend über 70 Prozent der Organisationen mit fragmentierten Datensilos, unvollständigen Informationen und inkonsistenten Systemlandschaften.

Die 3 größten Daten-Verbrechen in DACH-Unternehmen – und wie Sie sie stoppen
Sichern Sie sich den kostenlosen Bericht mit den Ergebnissen der HubSpot EMEA-Umfrage und erfahren Sie, wie Unternehmen in DACH Daten nutzen
- Die 3 häufigsten „Daten-Verbrechen“
- 5-Schritte-Plan zur Datenkompetenz
- 3 Praxisbeispiele aus DACH
- 3-Jahres-Fahrplan
Resilienz beginnt mit Klarheit
Resiliente Organisationen sind nicht nur sicherer, sie sind auch innovativer, weil sie auf eine stabile Wissensbasis bauen. Eine ganzheitliche Strategie stärkt die Datenresilienz durch mehrere Säulen:
Eine ganzheitliche Strategie für Datenresilienz
- Zentrale Plattformen: Einheitliche Systeme statt Tool-Wildwuchs schaffen die Basis für konsistentes Wissensmanagement.
- Automatische Sicherung: Regelmäßige Backups und strukturierte Ablagen stellen sicher, dass nichts verloren geht.
- Kulturelle Verankerung: Datenpflege wird zum selbstverständlichen Teil des Arbeitsalltags – nicht zur lästigen Zusatzaufgabe.
- Transparenz: Zugriff für alle relevanten Teams ohne Barrieren ermöglicht abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.
- Proaktive Planung: Prozesse für Offboarding, Wissenstransfer und Audit werden im Vorfeld festgelegt, nicht erst wenn Mitarbeitende kündigen.
Eine Handlungsempfehlung
Führen Sie ein Wissenssicherungs-Protokoll ein. Dokumentieren Sie systematisch das Wissen ausscheidender Mitarbeitender – von Kundenhistorien bis zu internen Prozessen. Erfassen Sie dabei, welche Informationen aktuell nur in persönlichen Notizen, E-Mails oder Chatverläufen liegen. So erkennen Sie Lücken im Wissensmanagement und schaffen die Grundlage, um Wissen langfristig im Unternehmen zu halten und neuem Personal den Einstieg zu erleichtern. Diese Investition zahlt sich mehrfach aus: durch schnellere Einarbeitung, bessere Kundenerlebnisse und höhere organisationale Resilienz.
Wissen ist nur dann Macht, wenn es zugänglich bleibt und flexibel abgerufen werden kann. Diese Erkenntnis mag trivial klingen, doch sie wird in der Praxis noch viel zu selten konsequent umgesetzt. Die Zahlen sprechen eben für sich: Während sich nur 16 Prozent der DACH-Unternehmen als wirklich datengetrieben sehen, verlieren 50 Prozent regelmäßig wertvolles Kundenwissen.
Der Unterschied zwischen erfolgreichen und kämpfenden Organisationen liegt nicht in der Menge der gesammelten Daten, sondern in der Fähigkeit, dieses Wissen systematisch zu bewahren, zu teilen und nutzbar zu machen. Unternehmen, die heute in Wissensmanagement investieren, schaffen morgen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum.
Datenmanagement